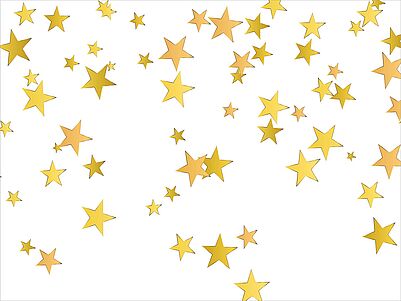Armut ist oft versteckt und schliesst aus
Kinder und Jugendliche in der Sozialhilfe

Dominik Thali

«Bei meiner Arbeit fällt mir auf, dass in Familien fast immer die Kinder mitbetroffen sind, wenn es um Armut geht», sagt Evelyne Kurmann. Ihre Kollegin Ursula Baumann, wie sie Sozialarbeiterin im Team der Sozialberatung der katholischen Kirche Stadt Luzern, macht die gleiche Erfahrung: «Ich höre oft von betroffenen Eltern, dass die Jugendphase der Kinder besonders anspruchsvoll sei.» Markenkleider, einmal in den Europapark gehen: «Das ist leider finanziell oft nicht möglich.»
Das soziale Existenzminimum
Kurmann und Baumann bestätigen die Feststellung, die eine wissenschaftliche Studie vor einem Jahr ergeben hat: Unter 18-jährige sind überdurchschnittlich oft von Armut betroffen und haben von allen Altersgruppen die höchste Sozialhilfequote: 4,8 Prozent, was 76 000 Kindern und Jugendlichen entspricht (siehe Kasten). Erhöht armutsgefährdet sind Einelternhaushalte, Paarhaushalte mit drei und mehr Kindern sowie Familien mit jüngeren Kindern. Fachpersonen schätzen, dass von der Sozialhilfe mitunterstützte Kinder «oftmals Einschränkungen erfahren, insbesondere bezüglich der sozialen Teilhabe, dem Zugang zu schulischen Unterstützungsangeboten und ihren Bildungschancen», heisst es in der Zusammenfassung. Die Studie betont: Es gibt nicht nur ein materielles Existenzminimum, das den Grundbedarf deckt – Wohnen, Essen, Gesundheit –, sondern auch ein soziales, das für die Teilhabe in der Gesellschaft steht.
«Armut ist ein Tabuthema»
Was sich dahinter verbirgt, bekommen die kirchlichen Sozialberatungen immer wieder zu spüren. Zu ihnen gelangen meist Betroffene, die zwar wenig haben, aber keine Sozialhilfe beanspruchen können oder darüber hinaus in Not sind. «Armut ist ein Tabuthema und schambehaftet», sagt Ursula Baumann. «Aus diesem Grund sprechen die Klientinnen und Klienten immer wieder von Einsamkeit. Vor allem möchten Eltern nicht, dass ihr Kind in der Schule als arm angesehen oder dann auch gehänselt wird. Diese Angst ist gross.»
Die Situation von Kindern in Armut verbessern
Die Studie «Die materielle Situation von Kindern und Jugendlichen in der Sozialhilfe», im Oktober 2024 veröffentlicht, zeigt auf, dass die heutigen Unterstützungsleistungen für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche in der Schweiz ungenügend sind und Lücken bei der Existenzsicherung bestehen. Absender der Studie sind die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren, die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe und die Städteinitiative Sozialpolitik.
Martina Helfenstein von der Ökumenischen Stelle Soziale Arbeit der Kirchen in Sursee nickt. Zudem erlebt sie, dass ihre Klient:innen oft lange warten, bis sie Hilfe suchen. «Erst möchte man selber aus der Situation herausfinden.» Dabei können die Kirchlichen Sozialberatungen manchmal unkompliziert helfen – auch weil sie wissen, dass die staatliche Sozialhilfe an enge gesetzliche Vorgaben gebunden sind. Helfenstein macht ein Beispiel: Über die Sozialhilfe wird einem Kind zwar die Mitgliedschaft in einem Sportverein bezahlt. «Wie kommt das Kind aber ins Training, wie an die Matches und wie zu den neuen Schuhen, die es vielleicht jährlich braucht?» Die Studie fordert deshalb unter anderem, eine monatliche Pauschale für bestimmte kinderspezifische Leistungen zu prüfen.
Helfenstein weist darauf hin, dass die Kirchen gerade auch für Menschen da sind, die knapp keinen Anspruch auf Leistungen des Staats haben. In Sursee hat so kürzlich eine Familie einen Anteil an die Spielgruppenrechnung erhalten, die 70 Franken Monatseinkommen zuviel erzielt und deshalb keine wirtschaftliche Sozialhilfe erhält.